Einfache und schnelle
Prüfung von GPS-Antennen
Hans
Glasmacher
Schneggstr.7,
85354 Freising
1. Wozu Antennenuntersuchungen?
Die erwarteten und
auch erreichbaren Anforderungen an die Genauigkeiten von GPS-Messungen steigen
immer weiter an, während sich die Benutzer immer weniger Gedanken über die
darin enthaltenen Fehlerkomponenten machen. Eine dieser Komponenten ist die
Richtungsabhängigkeit des Phasenzentrums der GPS-Antennen.
In der Anfangszeit
der Verwendung von GPS für die Vermessung war es selbstverständlich, daß die
Anntennen anhand einer Markierung nach Norden ausgerichtet wurden. Die zuerst
eingesetzten Antennen waren Helix-Antennen, die besonders große Richtungsfehler
aufwiesen. Da jedoch Antennen gleichen Typs innerhalb der Fertigungstoleranzen
weitgehend das gleiche richtungsabhängige Fehlerbild haben, wird der
richtungsabhängige Fehler bei gleicher Ausrichtung nach Norden bei der
differentiellen Auswertung zum größten Teil eliminiert.
Die Helix-Antennen
wurden bald von den Microstrip-Antennen abgelöst, deren Fehlerbeträge deutlich
kleiner waren und die auch physikalisch kleiner und leichter waren. Trotzdem
hatten die geodätischen Antennen weiterhin einen aufgedruckten Nordpfeil und
teilweise sogar einen eingebauten Kompaß, um größtmögliche Genauigkeit zu
erreichen. Für hochgenaue Meßkampagnen wurden oftmals alle Ausrüstungen zu
gemeinsamen Vergleichsmessungen zusammengezogen. Das Ziel, durch diese
Kalibrierungen die Genauigkeiten wesentlich zu steigern, wurde jedoch meistens
nicht erreicht.
Da heute zunehmend
kinematische und Stop&Go Verfahren mit sehr kurzen Aufstellzeiten
angewendet werden, wobei die Ergebnisse oftmals gleich in Echtzeit ausgewertet
werden, ist eine Ausrichtung der Antenne zu zeitraubend und nicht mehr üblich.
Dabei werden meist spezielle kleinere und leichtere Antennen eingesetzt. An den
Referenzstationen werden dagegen zur Vermeidung von Multipatheinfüssen
Antennen mit großen Groundplanes oder Choke-Rings eingesetzt werden. Die
Antennen sind daher nicht mehr gleichartig, wodurch sich auch die Ausrichtung
zur Elimination der richtungsabhängigen Fehler erübrigt.
Wie groß ist aber
nun letztendlich der richtungsabhängige Fehler des eingesetzten Systems, muß
sich nun der Benutzer fragen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß zumindest in
Bezug auf die Antennen das tatsächliche System aus der Differenz von Referenz-
und Rover-Antenne besteht. Dabei kann es außerdem vorkommen, daß die
Referenz-Antenne einem Referenzdienst gehört oder sonstwie unzugänglich ist und
daher nicht manipuliert werden werden kann.
Es gibt daher
Bedarf für eine einfache Systemuntersuchung vor Ort, die nachfolgend
vorgestellt wird. Der Anlaß, mich mit diesem Thema zu befassen, war die
Fertigstellung der ersten Prototypen eines neuen GPS-Systems. Die ersten
Untersuchungen waren natürlich der Vergleich und die Kalibrierung der
Prototypen gegenüber den bisherigen Systemen und untereinander. Da immer wieder
Modifikationen an den Prototypen vorgenommen wurden, mußten diese
Untersuchungen häufig wiederholt werden, wodurch der Gedanke an eine Rationalisierung
der Methode geweckt wurde.
2. Die Untersuchungsmethode
Der
richtungsabhängige Antennenfehler ist im allgemeinsten Fall eine Funktion von
Azimut und Elevation jedes empfangenen Signals in Bezug auf einen
antennenfesten Bezugspunkt, normalerweise der Mittelpunkt des 5/8 Zoll
Befestigungsgewindes, und eine markierte Bezugsrichtung. Diese Funktion kann
nur mit großem Aufwand ermittelt werden kann, zB. nach WÜBBENA (1996),
und muß dann bei der Basislinienenberechnung an jede einzelne Beobachtung entsprechend
angebracht werden. Dieser Aufwand steht aber nach bisherigen Erfahrungen in
keinem angemessenen Verhältnis zu dem Genauigkeitsgewinn. Die vorgestellte
Methode dient im Gegensatz dazu nur der Bestimmung des konstanten Anteils, der
von dieser Funktion abgespalten werden kann, und dessen Variabilität bei
unterschiedlichen Satellitenkonfigurationen.
Wenn man statt der
einzelnen Messungen nur die resultierenden Ergebnisvektoren betrachtet, so
beinhalten diese jeweils den konstanten Anteil, die Exzentrizität, und einen
von der Satellitenkonstellation abhängigen variablen Anteil. Durch
Wiederholungsmessungen einer bekannten Basislinie zu unterschiedlichen
Tageszeiten kann dann der konstante Anteil und die Variationsbreite des
restlichen Fehlers ermittelt werden.
Für die Messungen
richtet man sich am besten eine kurze Basislinie zwischen 1 bis 10 m ein und
verwendet möglichst eine Zwangszentrierung. In der näheren Umgebung sollten
sich keine reflektierenden Flächen befinden, da bei diesen kurzen Entfernungen
die Reflexionseinflüsse (Multipath) letztendlich den relativ größten Einfluß
haben.
Wenn die kurze
Basislinie nicht bereits genauestens bekannt ist, kann diese Bestimmung durch
einen Antennentausch zwischen den beiden Punkten erfolgen (Abbildung 1). Beim
Antennentausch muß man darauf achten, daß beide Antennen immer gleich
ausgerichtet werden, um die richtungsabhängigen Fehlereinflüsse zu eliminieren.
Die Basislinien vor und nach dem Tausch enthalten die beiden Antennenfehler mit
unterschiedlichen Vorzeichen. Daher ist das Mittel ((A-B)+(B-A))/2 frei von
beiden Antennenfehlern, während gleichzeitig die Differenz vor und nach dem
Tausch ((A-B)-(B-A)) die doppelte Differenz der beiden Antennenfehler enthält.
Abbildung 1 Abbildung
2
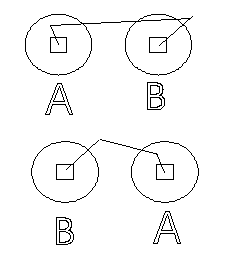
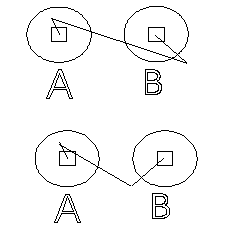
Der Antennentausch
ist übrigens auch die beste Methode, um für verschiedenartige Antennen, die in
einer gemeinsamen Messung gemischt eingesetzt werden sollen, die relativen
Höhen der Phasenzentren über den Bezugspunkten zu bestimmen bzw. kontrollieren.
Die Angaben zur Höhe des Phasenzentrums sind zwar konsistent zwischen den
Produkten eines Herstellers, können aber durchaus einen Konstanten Offset zu
denen eines anderen Herstellers haben. Dies resultiert daraus, daß das
Phasenzentrum nicht absolut, sondern immer nur relativ zu einer anderen Antenne
bestimmt werden kann. Das Phasenzentrum befindet sich nämlich nicht
zwangsläufig zentrisch innerhalb des physikalischen Volumens der Antenne,
sondern befindet sich meist im freien Raum darüber.
Wenn
man nun die zu untersuchende Antenne dreht, wie für die Antenne B in Abbildung
2 dargestellt, muß sich auch ein Fehler in der Zentrierung des Phasenzentrums
der Antenne um den Drehpunkt bewegen. Andererseits dreht sich aus der Sicht der
Antenne die Satellitenkonfiguration in entgegengesetzte Richtung, wodurch sich
die richtungsabhängigen Antennenfehler ändern. Das Ergebnis ist also die Summe
beider Fehlereffekte.
Durch 4 oder besser
8 Drehungen um jeweils 90 Grad erhält man genügend Stützpunkte für eine
Auswertung, wie anschließend in den Beispielen dargestellt. Um die Untersuchung
feiner aufzulösen, kann man natürlich auch um 6 mal 60, 8 mal 45 Grad oder,
wenn man symmetrische Fehler vermutet, um 3 mal 120 oder 5 mal 72 Grad drehen.
Wie bereits erwähnt, haben bei dieser Methode die Satellitengeometrie selbst
und der davon abhängige Multipatheinfluß den größten Einfluß. Die Qualität der
Ergebnisse ist daher unter diesem Aspekt um so besser, je schneller und kürzer
der Antennentausch und die Antennendrehung hintereinander erfolgen.
Das schnellste
geodätische Meßverfahren ist das Stop&Go Verfahren, bei dem die
GPS-Empfänger auch während der Bewegung von Punkt zu Punkt kontinuierlich
messen und in Kontakt mit den Satelliten bleiben. Mit dieser Methode können der
Antennentausch und 8 Drehungen, also eine Messreihe, ohne weiteres innerhalb
von 10 Messminuten durchgeführt werden. Innerhalb dieser Zeitspanne ist
normalerweise auch bei Einfrequenzempfängern eine Mehrdeutigkeitslösung “on the
fly” möglich.
Bei ungefähr 12
Stunden Umlaufzeit der Satelliten liegen die Geometrieänderungen innerhalb von
10 Minuten, oder +/- 5 Minuten Abweichung vom Mittelwert, bei (360_Grad *
5_Minuten / 12_Stunden) = +/-3 Grad. Die Meßreihe bildet daher einen
Schnappschuß der Auswirkungen der aktuellen Satellitenkonfiguration. Eine
zweite Messreihe, etwa eine Stunde später, zeigt dann schon die Variabilität
und den konstanten Anteil des Fehlers und somit die Größenordnung für die zu
erwartenden antenneninduzierten Positionsfehler.
Bei jedem Wechsel
der Antennenausrichtung wird jeweils eine neue Punktnummer vergeben, als wenn
ein neuer Punkt mit der Stop&Go Methode aufgemessen würde. Das für die
Beispiele verwendete Punktnummernschema ist in Tabelle 1 in der Spalte
“Eingabe” angegeben.
3. Ergebnisse in Beispielen
Nach der oben
beschriebenen Methode wurden verschiedene Antennen untersucht. Die Messungen
wurden auf einer sehr kurzen Basislinie von 1.5 Metern Länge mit fest
montierter Zwangszentierung durchgeführt. Die Basislinie war ungefähr in
West-Ost Richtung ausgerichtet, weshalb der Westliche Punkt mit W und der
östliche Punkt mit E bezeichnet wird. Die Bezugsantenne wird wie in den
Abbildungen 1 und 2 mit A bezeichnet, und die zu untersuchende Antenne mit B.
Da die Auswertungen
im Postprocessing erfolgten, wurden die Messungen jeweils ohne besondere
Vorlaufzeiten unmittelbar begonnen. Je nachdem, ob das Interesse mehr auf der
Nullpunkt-Bestimmung oder der Zentrierung der Antenne lag, wurde der
Antennentausch oder auch die zweite Drehung ausgelassen. Der Ablauf der
Messungen erfolgte immer nach dem gleichen Schema, das in Tabelle 1 dargestellt
ist.
Tabelle
1: Ablaufplan und Bezeichnungen
|
Punkt W |
Ausrichtung |
Eingabe |
Punkt E |
Ausrichtung |
Eingabe |
|
Ant. B |
N |
100 |
Ant. A |
N |
0 |
|
Ant. A |
N |
100 |
Ant B |
N |
1 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
E (90) |
2 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
S (180) |
3 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
W (270) |
4 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
N (360) |
5 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
E (90) |
6 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
S (180) |
7 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
W (270) |
8 |
|
” |
” |
” |
Ant B |
N (360) |
9 |
Die Untersuchungen
können bei einer echtzeitfähigen GPS-Ausrüstung auch ohne Postprocessing
durchgeführt werden. Im Gegensatz zu der oben dargestellten Vorgehensweise ist
dann lediglich in der ersten Aufstellungskonfiguration, Antenne B auf Punkt E
und Antenne A auf Punkt E, das Erreichen einer guten Mehrdeutigkeitslösung
abzuwarten. Das Warmlaufen der Empfänger vor der eigentlichen Messung erhöht
zudem sicherlich die Qualität der Ergebnisse, wenn dies auch von den Geräteherstellern
nicht ausdrücklich empfohlen wird.
Bei der
Untersuchung eines Systems mit Anschluß an eine unzugängliche Referenzstation,
wie zB. der eines kommerziellen Anbieters von Korrekturdaten, muß man sich
darauf verlassen, daß sich das mittlere Phasenzentrum auf die ausgewiesene
Position bezieht. Während der Drehung der untersuchten Antenne ist wegen der
geringen Geometrieänderungen während der Messung ein eventueller Einfluß eines
richtungsabhängigen Fehlers der Referenzantenne konstant. Ohne Antennentausch
kann man über die Koordinatenänderungen nur die Exzentrizität und die
Charakteristik der jeweils untersuchten Antenne ermitteln. Wiederholt man diese
Untersuchung jedoch bei unterschiedlichen Satellitenkonfigurationen, kann man
aber aus den Änderungen auch Rückschlüsse auf die Referenzantenne bzw. die
Unterschiede des richtungsabhängigen Fehlers zwischen beiden Antennen ziehen.
Die Auswertung
erfolgt am besten grafisch durch vergrößertes Abtragen der
Koordinatenunterschiede auf Papier oder durch Eingabe in eine
Tabellenkalkulation mit grafischer Punktdarstellung. Durch Linienverbindungen
in der Reihenfolge der Messung kann die Anschaulichkeit der Ergebnisse
verbessert werden. Nachfolgend werden einige Auswertungen von Untersuchungen
nach dieser Methode gezeigt. Die dargestellten Einheiten sind Millimeter.
Die Abbildung 3
zeigt sehr klar eine Exzentrizität der untersuchten Antenne. Die Linie beginnt
links oben bei Punkt 0 mit der Position bei getauschten Antennen und geht nach
rechts zu Punkt 1, der Ausgangsposition bei nordgerichteter Antenne. Der
Mittelpunkt X dieser Linie stellt demnach die fehlerfreie Basislinie dar. Der
Linienverlauf 1-2-3-4-5 bildet sehr klar erkennbar eine Rautenform, die einem
Quadrat nahekommt. Die Linie verläuft im Uhrzeigersinn entsprechend der
Drehrichtung der Antenne. Der Abstand der Punkte 1 und 5 zeigt die hohe
Auflösung der Messung trotz der kurzen Messzeit mit einer Wiederholgenauigkeit
von ca. 3 Millimetern.
Aus der Grafik kann
man relativ eindeutig auf eine Exzentrizität der Antenne schließen, deren
Vektor bei Nordausrichtung vom Mittelpunkt der Figur zum Punkt 1weist, bzw.
exakter vom Mittelpunkt M eines ausgleichenden Kreises K durch die Punkte 1 2 3
4 5 zum Schnittpunkt der Geraden M-1 mit K weist. Der Vektor vom
Kreismittelpunkt M zum Punkt X muß dann im übrigen nach den oben ausgeführten
Überlegungen der Fehler der zweiten Antenne sein.
Abbildung
3
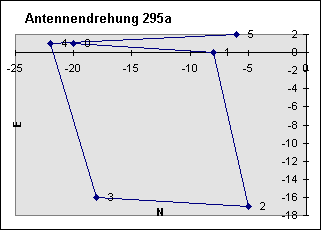
Die in Abbildung 4
gezeigte Untersuchung fand gleich im Anschluß an die vorhergehende mit einem
anderen Prototypen statt. Die Grafik zeigt im Prinzip die gleiche
Charakteristik, jedoch ist hier die Exzentrizität kleiner und in der Richtung
etwas anders. Die Punkte 1 und 5 liegen noch näher zusammen, wodurch die
Wiederholgenauigkeit bestätigt wird. Bei genauem Hinsehen fällt auf, daß der
Vektor M-X die gleiche Richtung und Größe wie in Abbildung 3 hat, denn es wurde
die gleiche Referenzantenne verwendet.
Abbildung
4
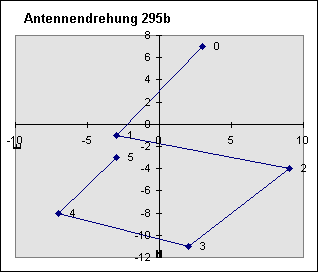
In Abbildung 5 ist
die erste Antennenuntersuchung der Serie dargestellt, die zu der oben
ausgeführten Methode geführt hat. Die ersten 5 Aufstellungen bzw. Ausrichtungen
wurden nach dem “Rapid-Static” Ansatz jeweils ca. 15 Minuten lang gemessen, und
die folgenden 5 Aufstellungen, hier abweichend mit 11 bis 15 bezeichnet,
jeweils nur 30 Sekunden lang nach der Stop&Go Methode. Die deutlich klarere
Ausprägung des Quadrats der Linie 11-12-13-14-15 zeigt die Größenordnung der
Verschmiereffekte durch die Konfigurationsänderungen während der Messung.
Abbildung
5
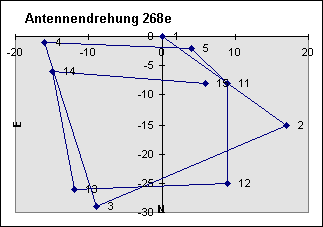
Nicht alle
untersuchten Antennen zeigen jedoch solch klare Charakteristiken. In Abbildung
6 sind die Untersuchungsergebnisse einer Antenne eines anderen Typs
dargestellt. Die Grafik zeigt ein ganz anderes, weniger klares Bild. Auch eine
Widerholungsmessung zeigte eine ähnliche Ausprägung. Die Punktpaare 1 5, 2 6
und 3 7 liegen nahe beieinander und zeigen die Wiederholmessgenauigkeit. Die
Punkte 8 9 fügen sich nicht in das Schema, was jedoch auf eine
Konstellationsänderung oder andere Effekte zurückzuführen sein kann. Auch bei
der Wiederholungsmessung zeigte sich jedoch die Form eines sehr flachen Trapezes
mit diagonaler Ausrichtung und einer Differenz zwischen Nord- und
Süd-Ausrichtung von ca. 20 Millimetern. Bei dieser Antenne liegt vermutlich ein
sehr stark unsymmetrisch ausgeprägter richtungsabhängiger Antennenfehler vor.
Abbildung
6

4. Resümee
Die dargestellte
Methode zur Antennenuntersuchung ermöglicht es auch dem “normalen”
GPS-Anwender, sein System auf einfache Weise im Felde zu untersuchen. Dies ist
vor allem dann anzuraten, wenn mit ausgeliehen Systemen gearbeitet wird und vor
allem, wenn “gemischte” Systeme verschiedener Hersteller eingesetzt werden. Die
Untersuchung ist zwar dazu gedacht, die Antennen zu kalibrieren, die Auswertung
vermittelt davon unabhängig aber auch ein Gefühl für den antenneninduzierten
Fehler. Wenn man nachvollzieht, wie groß letztendlich der richtungsabhängige
Antennenfehler im Verhältnis zum gesamten Fehlerbudget ist, wird man von Fall
zu Fall gegebenenfalls doch wieder die Antennen nach Norden ausrichten, wie in
den Anfängen der geodätischen GPS-Nutzung.
Literaturhinweise:
Wübbena, G., et al.
: A new approach for field calibration of absolute Antenna Phase Center
Variations. Proceedings ION GPS-96
N.N. : UNAVCO
1996 Annual Report, Chapter 4.1, Antenna Testing.
www.unavco.ucar.edu/gen_info/FY_reports/FY_96/annual96-1.html
Bawden, G. : UC
Davis Phase Center Test, Jan.28-Feb.3 1997. www.geology.ucdavis.edu/~bawden/phasecenter.html
Mader, G. L. : Antenna
calibration summary.
www.grdl.noaa.gov/GRD/GPS/Projects/ANTCAL/Files/summary.html